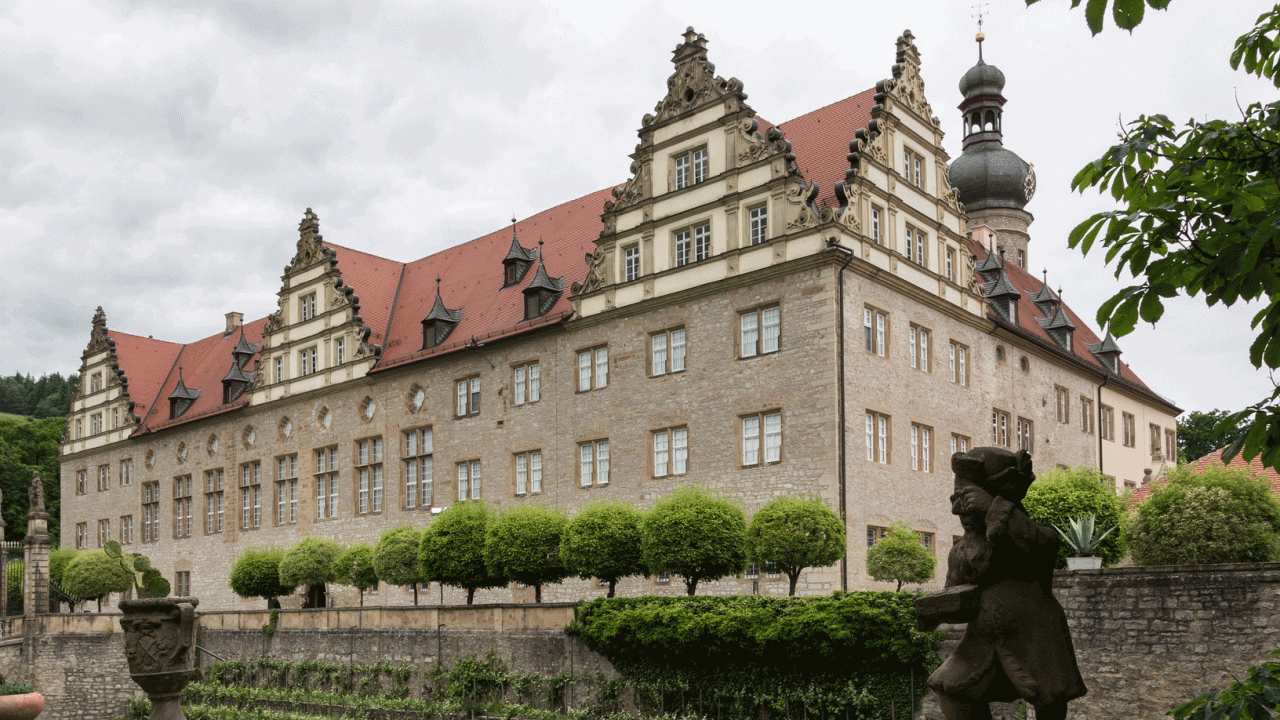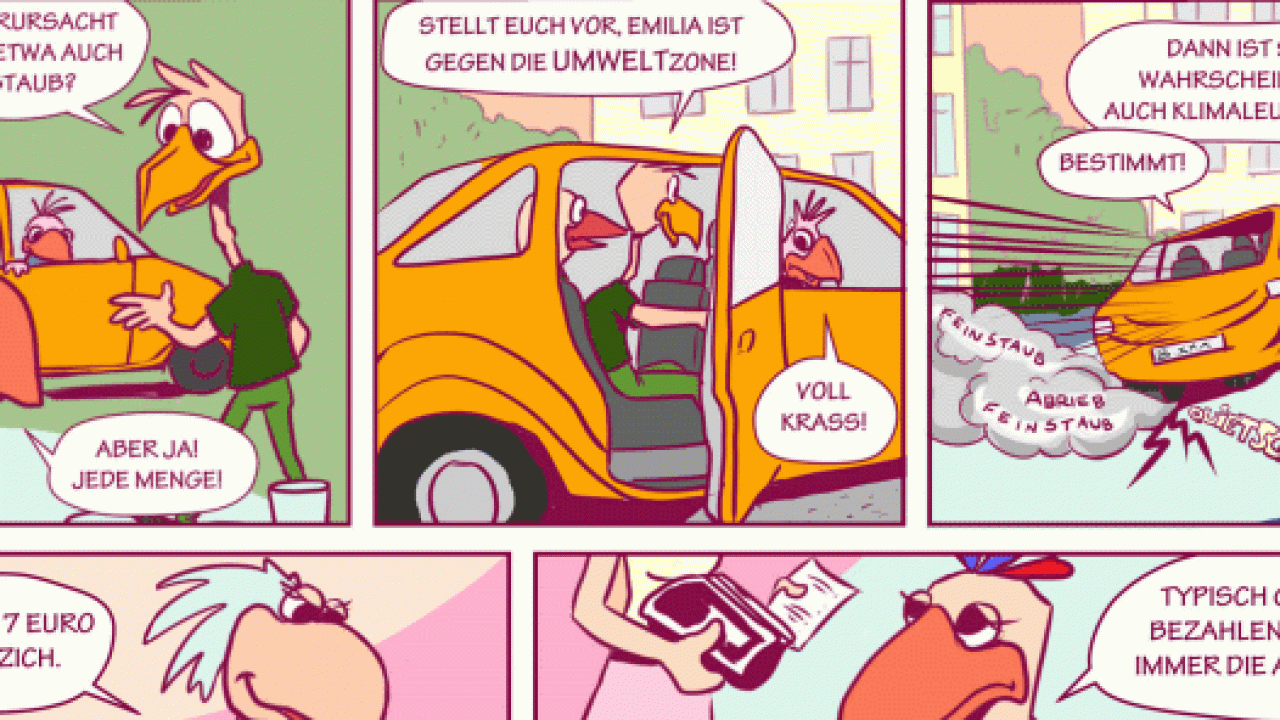Seit ihrer Gründung hat der Umgang mit der AfD in Politik, Medien und Gesellschaft verschiedene Phasen durchlaufen. Zunächst galt sie vielen als neue, konservativere FDP, eine wirtschaftsliberale Anti-Euro-Partei, kritisch beäugt von den Medien und möglicher Koalitionspartner für den rechten Rand der CDU. Mit der offenen Radikalisierung wandelte sich das Bild, die Partei wurde zum politischen Schmuddelkind, mit dem niemand im Sandkasten spielen wollte, dass sich aber gut als Pausenclown oder Quoten- und Clickbringer in politischen Talkshows und unzähligen – zu Recht – skandalisierenden Artikeln und Beiträgen eignete. Das wiederum nutzte die Partei gekonnt aus und genoss die Aufmerksamkeit, was Politik und Medien wiederum nicht entgangen ist. Angesicht sinkender und/oder stagnierender Umfragewerte ist das Problem heute vielleicht weniger virulent, eine wirklich befriedigende Lösung für den Umgang mit den Rechtspopulisten wurde trotzdem noch nicht gefunden.
„Protestpartei startet Anti-Euro-Wahlkampf“
So lautet die Überschrift eines Spiegel-Online-Artikels vom 14. April 2013 über den Gründungsparteitag der AfD. Als Gegenentwurf zur „Alternativlosigkeit“ mit der die Bundesregierung unter Angela Merkel für Rettungspakete und Euro argumentierte, sollte die AfD eben zur „Alternative“ werden. Tatsächlich war aber schon zu Anfang recht leicht zu erkennen, dass das Thema Euro bei weitem nicht das einzige war, was die Parteimitglieder bewegte. Außerhalb des Saales, in dem Bernd Lucke sich zum Vorsitzenden wählen ließ, wurde schon das gesagt, was auch vier Jahre später immer noch so oder so ähnlich zu hören ist, wie „Zeit-Online“ berichtete: „Man kann in diesem Land nicht mehr öffentlich seine Meinung sagen“; andere behaupten, dass die Homo-Ehe eine Verrat an der Demokratie sei. Auf der Facebookseite der Partei war der Slogan „Klassische Bildung statt Multikulti-Umerziehung“ zu lesen, bis er zum unverfänglicheren „Bildung statt Ideologie“ geändert wurde.
Vor allem die CDU fühlte sich von Anfang an von der neuen Partei von rechts bedroht. Wolfgang Bosbach, CDU-Bundestagsabgeordneter, sagte der „Wirtschaftswoche“, dass man „jetzt bloß nicht den Fehler machen [solle], die in die Schmuddelecke zu stellen“. Bei den Christdemokraten gab es Ängste, dass die neue Partei Mitglieder anziehen könnte, die nicht mit der Europapolitik der Kanzlerin oder ihrem Modernisierungskurs innerhalb der Partei zufrieden seien. Das CDU-Präsidium unter Angela Merkel setzte vor allem auf Ignorieren. Gerade aber konservative Stimmen innerhalb der Partei drängten darauf, sich mit den – scheinbar so harmlosen – „Eurokritikern“ auseinanderzusetzen.
Tatsächlich war die AfD mit ihren Slogans zum Euro zu Zeiten der Banken- und Griechenlandkrise erfolgreich. Bei den Bundestagswahlen im Gründungsjahr 2013 verpasste sie zwar den Einzug ins Parlament, erreichte allerdings aus dem Stand heraus 4,7 Prozent. Ein Jahr später zog sie dann mit sieben Prozent ins Europaparlament ein.
„Wie rechts ist die AfD?“
So überschreibt die „Bild am Sonntag“ ihr Interview mit dem damaligen Parteivorsitzenden Bernd Lucke im Oktober 2014. Nach mehr als einem Jahr real existierender AfD war fast allen Beobachtern klar, dass die „Anti-Euro-Protestpartei“ viel mehr ist als das: ein Sammelbecken verschiedenster rechter bis rechtsradikaler Strömungen. Im Interview wurde Lucke mit mehreren Fällen der letzten Monate konfrontiert – Holger Arppe, damals Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, war gerade wegen Volksverhetzung angezeigt worden, weil er jahrelang im Kommentarbereich der einschlägigen Hetz-Website „PI-News“ zur Gewalt gegen Muslime aufgerufen hatte; im Duisburger Stadtrat hatten AfDler einen NPD-Kandidaten unterstützt und Jan-Ulrich Weiß von der AfD-Brandenburg war wegen einer antisemitischen Karikatur, die er auf Facebook veröffentlicht hatte, wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Für Lucke waren das „relativ viele Einzelfälle“.
Für die CDU schien 2014 noch sehr unklar zu sein, wie mit der AfD umzugehen ist. Christean Wagner, Vertreter des konservativen „Berliner Kreises“ der CDU, schloss eine Koalition mit den Rechtspopulisten nicht aus und sagte dem Spiegel: „Ich bevorzuge eindeutig die FDP, aber halte es für einen taktischen Fehler, jetzt schon eine Zusammenarbeit mit der AfD für unmöglich zu erklären.“ Das gleiche galt für den CDU-Abgeordneten Klaus-Peter Willsch, der sagte, „Wir müssen für künftige Koalitionen nüchtern darauf blicken, mit wem wir die größten Schnittmengen haben: mit der SPD, mit den Grünen oder mit der AfD. Da sehe ich die größten Schnittmengen mit der AfD.“ Wolfgang Kauder dagegen, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagte der „Welt“, dass er nicht mal mit AfD-Vertretern in Talkshows sitzen möchte und betonte die Entscheidung des CDU-Präsidiums, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll. Und schließlich – doch sehr vorsichtig formuliert – stellte er fest: „Es gibt schon Hinweise, dass größere Teile der AfD sehr weit rechts verortet sind.“
„Mehr Pegida, weniger Lucke“
Die Überschrift eines Artikels auf der Website von n-tv war, obwohl schon im Januar veröffentlicht, programmatisch für das gesamt kommende Jahr 2015. Auf dem Essener Parteitag verlor Bernd Lucke den Parteivorsitz. Er trat aus und gründete ALFA („Allianz für Fortschritt und Aufbruch“, nach einer Namensänderung heute „Liberal-Konservative Reformer“), eine Partei, deren Umfragewerte so niedrig sind, dass sie nicht gemessen werden können. Die Partei wird nicht an den Bundestagswahlen 2017 teilnehmen.
Die Radikalisierung der AfD wurde derweil immer deutlicher. Mit Lucke hatte eine medial relativ präsente Person die Partei verlassen. Sein Platz in den Talkshowsesseln der Republik wurden jetzt durch viel stärker polarisierendes AfD-Personal gefüllt: LGBT*-Feindin Beatrix von Storch, Frauke Petry oder Björn Höcke, der mit einem Polyacryl-Deutschlandfähnchen bei Günther Jauch saß. Für viele Beobachter stellte sich die Frage, inwieweit den Rechtspopulisten überhaupt eine so große Bühne geboten werden sollte.
Nach Bernd Luckes Abgang entwickelte sich der Politikstil der AfD immer mehr in Richtung Empörungs-Clickbait, das immer auf die gleiche Art funktioniert: Eine AfD-Vetreter_in sagt öffentlich Skandalöses, Öffentlichkeit und Medien springen darauf an, die Vertreterin_in rudert gegebenenfalls zurück, behauptet, die eigene Äußerung sei so nie gefallen oder aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ein Paradebeispiel dafür lieferten Marcus Pretzell, Frauke Petry und Beatrix von Storch im Januar 2016. Zuerst sprach Pretzell – schon Monate vorher – auf einer Parteiveranstaltung und später auch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur davon, dass „die Verteidigung der deutschen Grenze mit Waffengewalt als Ultima Ratio (…) eine Selbstverständlichkeit“ sei. Petry nahm diese Aussage auf und antwortete im Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ auf die Frage, wie ein Grenzpolizist reagieren solle, wenn er einen „illegalen“ Grenzübertritt bemerkt mit den Worten: „Er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im Gesetz.“ Unmittelbar danach antwortete Beatrix von Storch auf die Frage eines Nutzers auf ihrer Facebookseite, ob auch auf Frauen und Kinder geschossen werden solle lakonisch nur mit „Ja“. Frauke Petry behauptete danach, sie hätte den Satz so nicht gesagt, von Storch erging sich in kruden Erklärungen, warum sie so auf ihrer Facebookseite reagiert hat. Die Medien waren aber so oder so empört und es wurde über die AfD berichtet.
Später gelangte eine E-Mail von Petry an die Öffentlichkeit, in der sie diese Strategie erklärt: „Um sich medial Gehör zu verschaffen, sind daher pointierte, teilweise provokante Aussagen unerlässlich. Sie erst räumen uns die notwendige Aufmerksamkeit und das mediale Zeitfenster ein, um uns in Folge sachkundig und ausführlicher darzustellen.“
„Das Superwahljahr für die AfD“
Die Überschrift im Handelsblatt aus dem Januar gab einen Ausblick auf den Erfolg der AfD 2016. Die Medienstrategie der Partei schien aufzugehen. 2016 wurde in vier Bundesländern und in Berlin gewählt, überall erhielt die Partei zweistellige Ergebnisse, in Sachsen-Anhalt wurde sie mit 24,3% gar zweitstärkste Kraft.
Spätestens jetzt gingen die etablierten Parteien sehr eindeutig auf Distanz. Sigmar Gabriel, damals noch SPD-Parteivorsitzender, nannte die AfD „offen rassistisch“ und verglich sie verklausuliert mit der NSDAP, der baden-württembergische Innenminister Thomas Stroble (CDU) sagte im Interview mit der Tagesschau, „die AfD ist eine Schande mit Parteistatut.“ FDP-Chef Lindner nannte die Partei „die wahren Feinde unserer Gesellschaft.“
Überraschender ist vor allem die Reaktion des eigentlichen klassischen Gegenspielers der Rechtspopulisten, die der Links-Partei. Im Oktober 2016 trafen sich die Chefinnen der beiden, sich eigentlich diametral gegenüberstehenden Parteien, zu einem gemeinsamen Gespräch, das in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ abgedruckt wurde. Sahra Wagenknecht und Frauke Petry fanden dabei durchaus Gemeinsamkeiten. Wagenknecht, die schon nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln von „verwirktem Gastrecht“ gesprochen hatte, relativierte die Linken-Forderung nach offenen Grenzen für alle als „eine gute Forderung für eine Welt der Zukunft, in der die Menschen überall in Wohlstand leben“, aber eben keine für die Realität im Deutschland des Jahres 2016. Auch in anderen Bereichen der Flüchtlingspolitik waren die beiden Parteichefinnen auf gleicher Linie. Wagenknecht kritisierte indirekt die Politik der Kanzlerin und forderte, dass Arbeitsplätze und Wohnungen vorhanden sein müssten, wenn man Geflüchtete aufnimmt. Gleichzeitig legte sie Wert auf die Beseitigung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern. Frauke Petry: „Damit haben Sie gerade AfD-Positionen referiert, Frau Wagenknecht.“
Aber nicht nur an der Spitze sind die Übergänge fließend. Gerade einen Monat vor dem Interview wurde die AfD mit 20.8 Prozent zweitstärkste Partei bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. 16.000 ihrer Wähler_innen hatten fünf Jahre zuvor ihr Kreuz noch bei der Linken gemacht.
Unterdessen radikalisierte sich die AfD immer weiter. In Baden-Württemberg wurden die – eigentlich schon lange öffentlichen und Parteifreunden bekannten – antisemitischen Thesen des AfD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon publik. Ihn aus der der Landtagsfraktion oder der Partei auszuschließen scheiterte. Gedeon trat schließlich freiwillig aus der Fraktion aus, blieb aber weiterhin Parteimitglied. Frauke Petry kam immer stärker unter Druck. Der Bundesparteitag 2017 in Köln glich schließlich dem Essener Parteitag 2015. Ähnlich wie Bernd Lucke, wurde Petry aufs Abstellgleis gestellt. Sie blieb Parteivorsitzende, ihre Anträge wurden aber größtenteils ignoriert. Wahrscheinlich auch unter dem Eindruck sinkender Umfragewerte und schlechterer Ergebnisse bei den Landtagswahlen 2017, will die Partei jetzt Fundamentalopposition betreiben und nicht Petrys Plan folgen, perspektivisch regierungsfähig zu werden.
Dazu gehören auch klare Feindbilder. Laut einem geleakten Strategiepapier der Rechtspopulisten sind vor allem „Die Grünen (…) der eigentliche politische Gegner der AfD. (…) Man kann geradezu die Gleichung aufstellen, dass immer dann, wenn die Grünen eine politische Auffassung vertreten, aus AfD-Sicht automatisch genau das Gegenteil richtig wäre.“ Umgekehrt funktioniert das genauso. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag sagt: „Wir sind der Gegenpol der AfD“. Und tatsächlich positioniert sich keine der demokratischen Parteien so gegen die Rechstpopulisten wie Bündnis 90/Die Grünen. Diese Haltung ist in der Partei selbst nicht unumstritten. Gerade der rechte Flügel um Deutschlands einzigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann kritisiert zuweilen den angeblich so harschen Umgang. Kretschmann schrieb gar 2016 in der „Zeit“, dass die Grünen zum Erstarken der AfD indirekt beigetragen hätten. Die vor allem von den Grünen mitgetragenen gesellschaftspolitischen Veränderungen wie Gleichstellung und LGBT*-Rechte seien zwar in der Gesellschaft angekommen. Die Modernisierungsverweigerer erlebten aber einen „Kontrollverlust“ und würden sich „nach der alten Ordnung und der Übersichtlichkeit vergangener Zeiten“ sehnen. Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister in Tübingen sprang ihm zur Seite: „15 bis 20 Prozent der Wähler darf man nicht beschimpfen, ausgrenzen, herabsetzen oder für dumm erklären. Leider tun das manche Grüne allzu oft.“
„Björn Höcke würde ich heute nicht mehr einladen“
So zitiert die „Zeit“ Talk-Masterin Maybritt Illner in einem Interview. Und tatsächlich scheinen die dauerempörten und deswegen unterhaltsamen AfD-Politiker_innen nicht mehr so häufig in Talkshows zu sitzen, wie man es aus den letzten Jahren gewohnt war. Das Talkshow-Verbot gilt allerdings nicht generell, so lud Illner Beatrix von Storch zu einer Sondersendung ein. Allerdings durfte die AfDlerin nicht in der großen Runde sitzen, sondern wurde nur wenige Minuten lang an einem separaten Tisch befragt.
„Zwischen Ausgrenzen, Abgrenzen und Ignorieren“
Parallelen zum Umgang mit der AfD in der Öffentlichkeit zeigen sich im parlamentarischen Umgang mit der Partei. Das „Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung“ (WZB) geht in seiner Studie „Parlamentarische Praxis der AfD in den Landesparlamenten“ unter anderem auf diesen Punkt ein. Vor allem nach dem Einzug der Rechstpopulisten in verschiedene Parlamente wurde vor allem im Westen der Republik versucht, die Partei auszugrenzen. Geschäftsordnungen wurden geändert, um die neugewählten Landesvertreter aus Ausschüssen fernzuhalten oder um die Redezeiten kurz zu halten. Das erwies sich nicht als erfolgreiche Strategie. Abgeordnete konnten „sich als (…) Opfer inszenieren, das durch die etablierten Fraktionen in der Ausübung seiner Rechte eingeschränkt wurde. „Ähnliches passierte, wenn Abgeordnete der etablierten Parteien sich öffentlich oder im Parlament direkt auf die immer wieder vorkommenden rassistischen Ausfälle der Rechstpopulisten einschossen: „Statt die AfD-Mitabgeordneten überzeugend auf die parlamentarischen Gepflogenheiten festzulegen, wertete man sie auf, gab ihnen das, was sie wollten: die öffentliche Bühne.“
Eine wahrscheinlich bessere Strategie kristallisierte sich erst mit der Zeit heraus: klare Abgrenzung und inhaltliche Auseinandersetzung. Hier versucht man zwischen legitimen Meldungen und purer Provokation zu unterscheiden. Einerseits setzt die Partei Themen auf die politische Agenda, von denen Teile der Bevölkerung zu glauben scheinen, dass sie nicht genug politische Aufmerksamkeit erfahren. Darauf versuchen die etablierten Parteien zu reagieren, indem sie die Diskussion versachlichen. Andererseits ist Provokation für die AfD nicht nur eine Taktik, die in der Medienöffentlickeit stattfindet, sondern genauso in den Parlamenten: „So sehen sich die politischen Konkurrenten der AfD in einem Dilemma: Einerseits müssen die anderen Parteien ein eigenes Interesse daran haben, die von der AfD besetzten Themen nicht kampflos der Konkurrenz zu überlassen, sondern Angebote für drängende politische Fragen zu schaffen. Andererseits sehen sie sich der Gefahr gegenüber, über jedes Stöckchen zu springen, das ihnen von der AfD hingehalten wird.“
Raus aus dem Teufelskreis
Vier Jahre AfD und der Umgang mit den Rechtspopulisten in Medien, Öffentlichkeit und den Parlamenten ist immer noch schwierig. Ignoriert man die Partei, ignoriert man auch einen Teil der Bevölkerung. Die AfD deckt eine Grauzone ab, die zwischen – vielleicht unschönen – aber demokratisch zu tolerierenden Meinungen und rassistischem und völkischem Gedankengut existiert. Die Partei ist in Personal und Meinungen zu homogen und zumindest in Teilen nicht rechtsextrem, sondern eben „nur“ rechtspopulistisch, um ihre Wähler für die Demokratie verloren zu geben. Gleichzeitig würde man damit den Parteistrategen in die Hände spielen. Die AfD hat mit rechtspopulistischen und neurechten Blogs, Zeitschriften und Zeitungen und nicht zuletzt mit sovielen Facebookfans, wie CDU und SPD zusammen, eine ganz eigene Gegenöffentlichkeit aufgebaut. Berichten die sogenannten „Mainstreammedien“ nicht mehr oder mauern Parteien, dauert es nicht lange, bis AfD und Konsorten empört „Meinungsfreiheit“ schreien und damit den eigenen Anhängern suggerieren, Teil einer unterdrückten Minderheit zu sein. Dadurch werden Fronten verhärtet. Gleichzeitig gibt es aus der Partei immer wieder so rassistische, antisemitische oder schlicht menschenfeindliche Statements, dass diese zu benennen und ihnen zu widersprechen zur Pflicht von Medien und Politik gehört. Und trotzdem hat die Partei wieder erreicht, was sie wollte: In den Schlagzeilen zu stehen. Wie sich diese Situation im Wahljahr 2017, vor allem auch mit Blick auf die sinkenden Umfragewerte der AfD entwickeln wird, bleibt abzusehen.