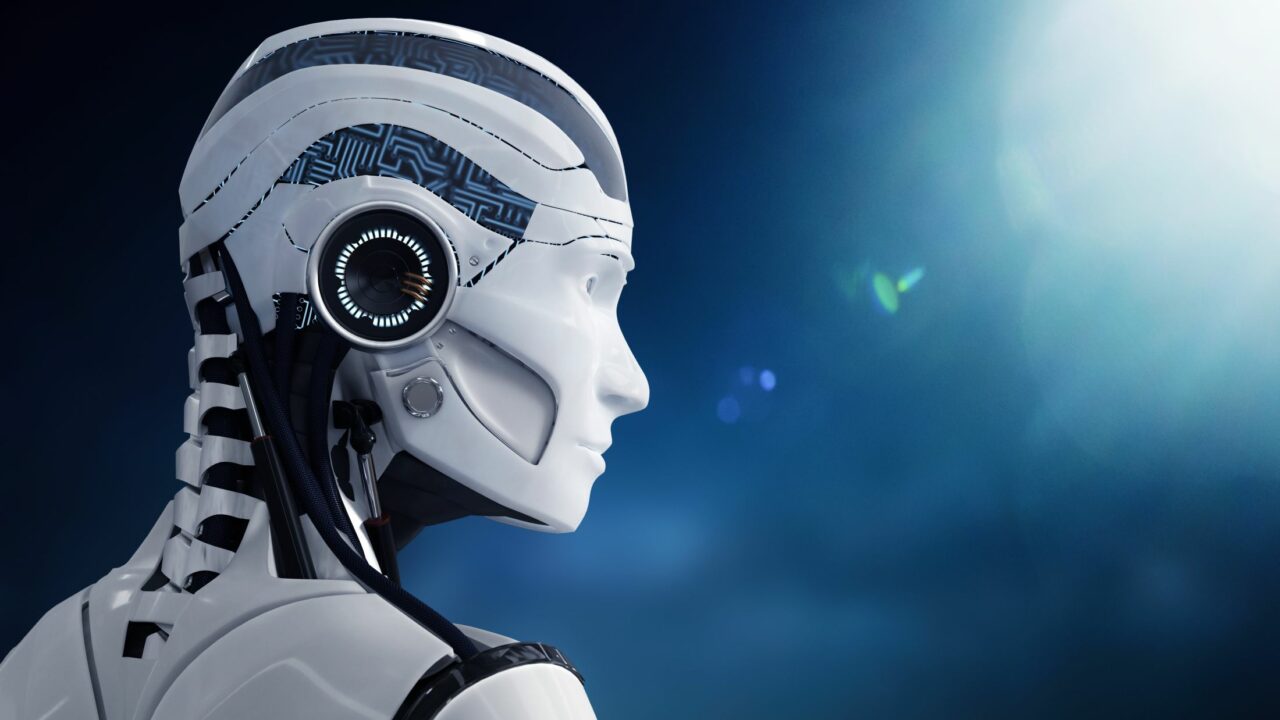Die SPD hat in einem Positionspapier einen Vorschlag zur Regulierung von Social Media für Minderjährige vorgelegt. Statt eines kompletten Verbots legen die Sozialdemokraten einen abgestuften Vorschlag vor, der junge Menschen in drei Altersgruppen einteilt. Auch Erwachsene werden nicht vergessen.
Der Vorschlag der Sozialdemokraten sieht ein vollständiges Verbot für Kinder unter 14 Jahren vor. Dabei ist anzumerken, dass viele Plattformen die Nutzung ohnehin erst ab 14 Jahren erlauben, nur TikTok beispielsweise ab dem dreizehnten Lebensjahr. Um das wirksam durchzusetzen, sollen Anbieter laut Positionspapier verpflichtet werden, den Zugang technisch zu unterbinden. Verstöße von Plattformen sollen schnell und spürbar sanktioniert werden. Greift das dann auch bei der Verbreitung von hasserfülltem Content?
Für Jugendliche bis 16 Jahre schlägt die SPD eine verpflichtende Jugendversion der Plattformen vor. Diese soll ohne algorithmisch gesteuerte Feeds, Empfehlungssysteme oder personalisierte Inhalte auskommen. Zudem sollen suchtverstärkende Funktionen wie Endlos-Scrollen, automatisches Abspielen von Inhalten, Push-Benachrichtigungen, Gamification-Elemente oder nutzungsabhängige Belohnungssysteme untersagt werden.
Ab 16 Jahren soll der Zugang erlaubt sein, allerdings über eine Jugendversion der jeweiligen Plattformen. Diese müssten bestimmte Anforderungen erfüllen, etwa keine algorithmisch gesteuerten Feeds und somit keine personalisierte Inhaltsausspielung. Außerdem sollen Endlos-Scrollen, Pushnachrichten, Gamifizierung sowie automatisches Abspielen der Inhalte unterbunden werden. Zur Altersverifikation ist die EUDI-Wallet-App vorgesehen, eine Art digitales Portemonnaie, in dem unter anderem Ausweisdaten der Erziehungsberechtigten hinterlegt werden sollen.
Standardmäßige Deaktivierung des personalisierten Contents
Neben der Jugendversion der Plattform soll es noch eine große Änderung geben, die dann auch erwachsene Personen betreffen wird. Zu Beginn sollen bei allen die Empfehlungssysteme standardmäßig deaktiviert werden, also auch bei erwachsenen User*innen. Nutzer*innen müssten sich dann aktiv dafür entscheiden, wenn sie algorithmische Vorschläge, also personalisierten Content, erhalten möchten. Auch diese Altersgruppe müsste sich dem Vorschlag zufolge künftig über die EUDI-Wallet verifizieren.
Der Vorstoß der SPD fügt sich damit nahtlos in eine Debatte ein, die längst nicht mehr sachlich geführt wird, sondern zunehmend emotional aufgeladen ist. Kaum ein anderes Thema bündelt derzeit so viele Projektionen, Ängste und politische Reflexe wie der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Social Media. Was als Schutzdebatte beginnt, kippt schnell in Grundsatzfragen über Demokratie, Verantwortung und Kontrolle.
Anspannung, Aufregung, Alarmismus und Adultismus
Der Vorschlag trifft auf ein politisches und gesellschaftliches Klima, das bereits stark unter Spannung steht. Zwischen berechtigter Sorge, symbolischer Politik und Wahlkampfinszenierung verschwimmen die Grenzen zunehmend. Anspannung, Aufregung und Alarmismus prägen die aktuelle Diskussion.
Die Situation ist angespannt, weil sich kaum leugnen lässt, dass Demokratiefeinde viel zu lange auf den Plattformen agieren konnten. Menschenfeindliche Narrative, Desinformation und digitaler Hass konnten über Jahre ihren Weg über soziale Medien in die Gesellschaft finden. Die Warnungen und der Ruf nach einem konsequenten Handeln waren da. Die neusten Zahlen der DAK Studie laut der 350.000 Jugendliche süchtig nach Social Media sind, zeigen noch einmal deutlich den Kern des Problems. Aber auch wenn wir vom Suchtfaktor den Blick auf Demokratiegefährdung legen, lässt sich die Herausforderung nicht von der Hand weisen.
Grundrechte unter Vorbehalt
Auf den aktuellen SPD-Vorschlag wird unterschiedlich reagiert, und viele sind sich auch bei diesem Aufschlag einig, dass auch dieses Mal wieder der Ansatz viel zu kurz gedacht ist. Die Einigkeit wird von einem weiteren Muster durchzogen: Es wird berechtigterweise von der Beschneidung von Grundrechten gesprochen und auch, dass diese Entscheidung an Kindern und Jugendlichen vorbei entschieden wird, hat erneut einen faden Beigeschmack.
In den Diskussionen werden altbekannte Vergleiche mit dem Straßenverkehr gezogen: Verkehrserziehung und Führerschein fürs Internet, werden dabei diskutiert. Aber: wie soll man lernen, wenn man den Raum gar nicht betreten darf? Das Fazit ist klar: Medienkompetenz entsteht nicht durch Aussperren, sondern durch Begleitung.
Kapitulation, verpackt in Fürsorge
Der Tagesspiegel titelt „Kapitulation, verpackt in Fürsorge“ und passender kann man es kaum sagen. Denn unter dem Deckmantel des Schutzes wird vor allem eines sichtbar: Ratlosigkeit. Und ein (symbol)politischer Reflex, der nach Verboten ruft, wenn es kompliziert wird. Da ist es besonders fatal, dass dies nun ausgerechnet Verhandlungsgegenstand im Wahlkampf wird.
Politik über die Köpfe von jungen Menschen statt mit ihnen, das ist keine gute Idee und leider auch nicht neu. Und als Wahlkampfthema ist es ehrlich gesagt auch nicht sehr elegant, wenn man die Wichtigkeit des Themas ernst nimmt. Denn hier wird nebenbei das Grundrecht auf Information eingeschnitten.
Wie wäre es stattdessen mit Investitionen? In Infrastruktur für junge Menschen. Eine kindgerechte Suchmaschine wie „Blinde Kuh“ musste aus Geldgründen im Januar 2024, nach 27 Jahren, ihren Dienst einstellen. Warum fördert man so etwas nicht?
Wenn es der Politik tatsächlich darum geht, dass Kinder und Jugendliche sich wieder häufiger analog begegnen oder ihre Hausaufgaben nicht primär über TikTok oder YouTube organisieren, dann braucht es vor allem eines: Investitionen. In Jugendzentren, offene Treffpunkte, Freizeitangeboten und verlässlicher Hausaufgabenhilfe. Es geht darum, Räume zu schaffen, nicht darum, sie weiter zu schließen.
Die Mittel dafür wären vorhanden. Ob sie eingesetzt werden, ist eine politische Entscheidung. Ein Verbot hingegen erlaubt es, sich symbolisch selbst auf die Schulter zu klopfen und gleichzeitig die seit Jahren geforderte Finanzierung einer breiten, intergenerationalen Medienkompetenzbildung elegant zu umgehen. Frei nach dem Motto: Ist das Problem verboten, braucht es keine Förderung mehr.
Adultismus: Entscheiden über junge Menschen
Auch die Debatte um „Smartphone-Verbote für Boomer“, die der Creator Levi Penell im letzten Herbst provokant bei “hart, aber fair” in den Raum gestellt hat und dafür viel Zustimmung, aber vor allem auch Hass kassierte, macht vorwiegend eines deutlich: Verbote wirken für diejenigen, die davon betroffen sind, schnell absurd. Ein Perspektivwechsel würde der aktuellen Debatte guttun.
Dieser fehlt bislang jedoch weitgehend, etwa beim Blick auf die Zusammensetzung der Expertinnenkommissionen des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“. Noch schwerer wiegt jedoch, dass in diesen Gremien zentrale Perspektiven kaum vertreten sind: Medienpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Elternvertretungen, Lehrkräfte und vor allem junge Menschen selbst. Das hat auch einen Namen: Adultismus. Erwachsene entscheiden über junge Menschen, anstatt mit ihnen und verkaufen Verbote als Fürsorge.
Alter schützt nicht vor digitaler Naivität
Man stelle sich einmal vor, unter 30-Jährige würden geschlossen ein breites und allgemeingültiges Social-Media-Verbot für Boomer fordern. Begründet wurde dies damit, dass Menschen aus älteren Generationen auch Probleme haben, die Inhalte, die sie in sozialen Medien und zum Beispiel auch KI-Inhalte sehen, immer richtig einzuschätzen, ob es sich um verzerrte oder gar falsche Informationen handelt und dass daher ein konsequenter Ausschluss gefordert werden müsse.
Wie würde eine solche Forderung gesamtgesellschaftlich verhandelt werden? Sie wäre entmündigend, übergriffig und an der Zielgruppe vorbei. Einigkeit herrscht darüber, wie akut die derzeitigen Probleme für unsere Demokratien sind. Klar ist: es braucht Auseinandersetzung, Regulierung und politisches Handeln. Doch nicht nur Kinder und Jugendliche sind von diesen gefährlichen Inhalten betroffen, die Einfluss auf ihre Meinungsbildung nehmen können. Die aktuelle Debatte dreht sich also in diesem Fall stark um Jugendliche und um das Suchtpotenzial, was auf der Hand liegt, insbesondere mit Blick auf Schutz und Verantwortung gegenüber Schutzbefohlenen. Wenn das eigene Medienverhalten in Gänze betrachtet wird, resultiert daraus die Frage, ob Erwachsene frei von Sucht sind? Ob Erwachsene immun dagegen sind, auf demokratiefeindliche Desinformationsnarrative hereinzufallen, ist fraglich. Ein Blick auf die Plattformen selbst reicht aus, um zu erkennen, dass dies keineswegs ein Automatismus ist. Alter schützt nicht vor digitaler Naivität – leider.
Das hängt auch damit zusammen, wie erfolgreich die Strategien von Demokratiefeinden in den vergangenen Jahren im Internet und in sozialen Medien auf fruchtbaren Boden fallen konnten. Plattformspezifische Funktionen belohnen Empörung, Emotionen und Hass, während Komplexität und differenzierte Auseinandersetzungen mit gesellschaftlich polarisierenden Themen weniger Sichtbarkeit erhalten.
Hinzu kommt, dass nicht nur der digitale Raum Einfluss auf demokratische Entwicklungen nimmt. Digitaler und analoger Raum stehen in einer wechselseitigen Beziehung: Sie verstärken einander und knüpfen an Emotionen, Vorurteile und Ideologien an, die in der Gesellschaft verankert sind und auf historisch gewachsenen Diskriminierungs- und Machtverhältnissen beruhen. Es wäre sinnvoller, politischen Druck auf Plattformen aufzubauen, dass die Algorithmen transparenter sein, für die Forschung ausgegeben werden müssen und Algorithmen zu regulieren, damit Inhalte, die sachlich sind, nicht bestraft werden. Man muss beginnen, den Demokratiefeinden ihre technischen Stecker zu ziehen.
Und noch etwas: Demokratiefeinde gibt es nicht nur auf TikTok, Pinterest oder Instagram. Die gab es schon immer in Foren, auf Webseiten, in Kommentarspalten. Wer es ernst meint, müsste endlich konsequenter gegen Plattformen und Betreiber vorgehen, die problematische Inhalte dulden. Das ist nur anstrengender, als ein Verbotsschild und Absperrungen aufzustellen. Vielleicht wäre der nachhaltigere Punkt: nicht den einfachen Weg wählen, sondern einen konsequenten und multiperspektivischen Weg. Laut sein, wo es nötig ist. Investieren, wo es Sinn ergibt, und junge Menschen und Jugendschutz ganzheitlich ernst nehmen.
Ohne EU-Perspektive läuft nichts
Ein nationaler Alleingang erscheint im Übrigen wenig sinnvoll, wenn man bedenkt, dass viele der Plattformen, die von einem Social Media-Verbot betroffen wären, ihren Sitz in anderen EU-Ländern haben. Plattformbetreiber könnten klagen, zudem kollidiert ein solcher Ansatz mit dem Herkunftslandprinzip: Es gelten die Regeln des EU-Landes, in dem die Plattform ihren Sitz hat. In der Praxis müsste also ein System geschaffen werden, das von der europäischen Gemeinschaft getragen wird. Andernfalls droht ein ähnliches Debakel wie die Maut, um in der Straßenverkehrslogik zu bleiben.